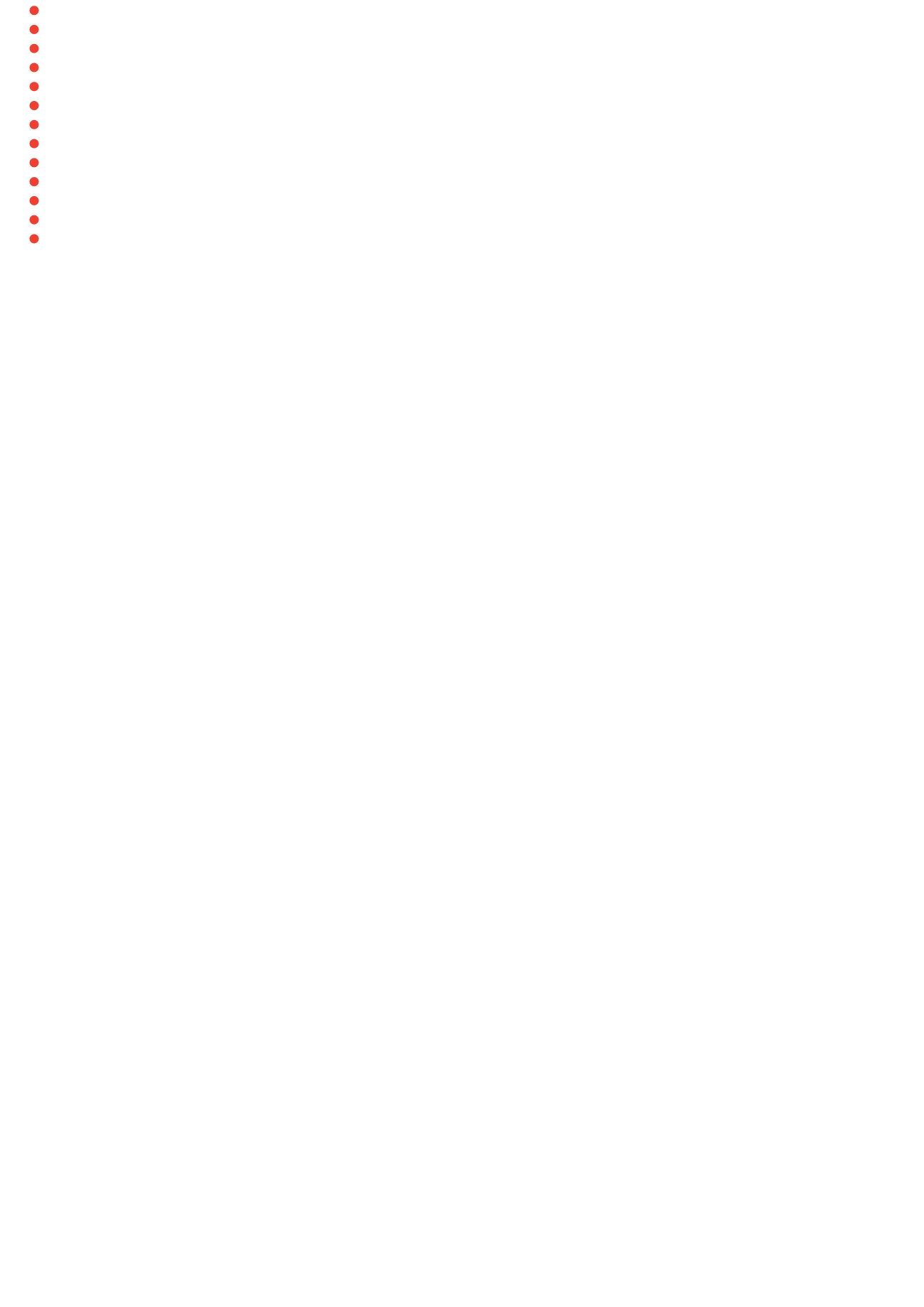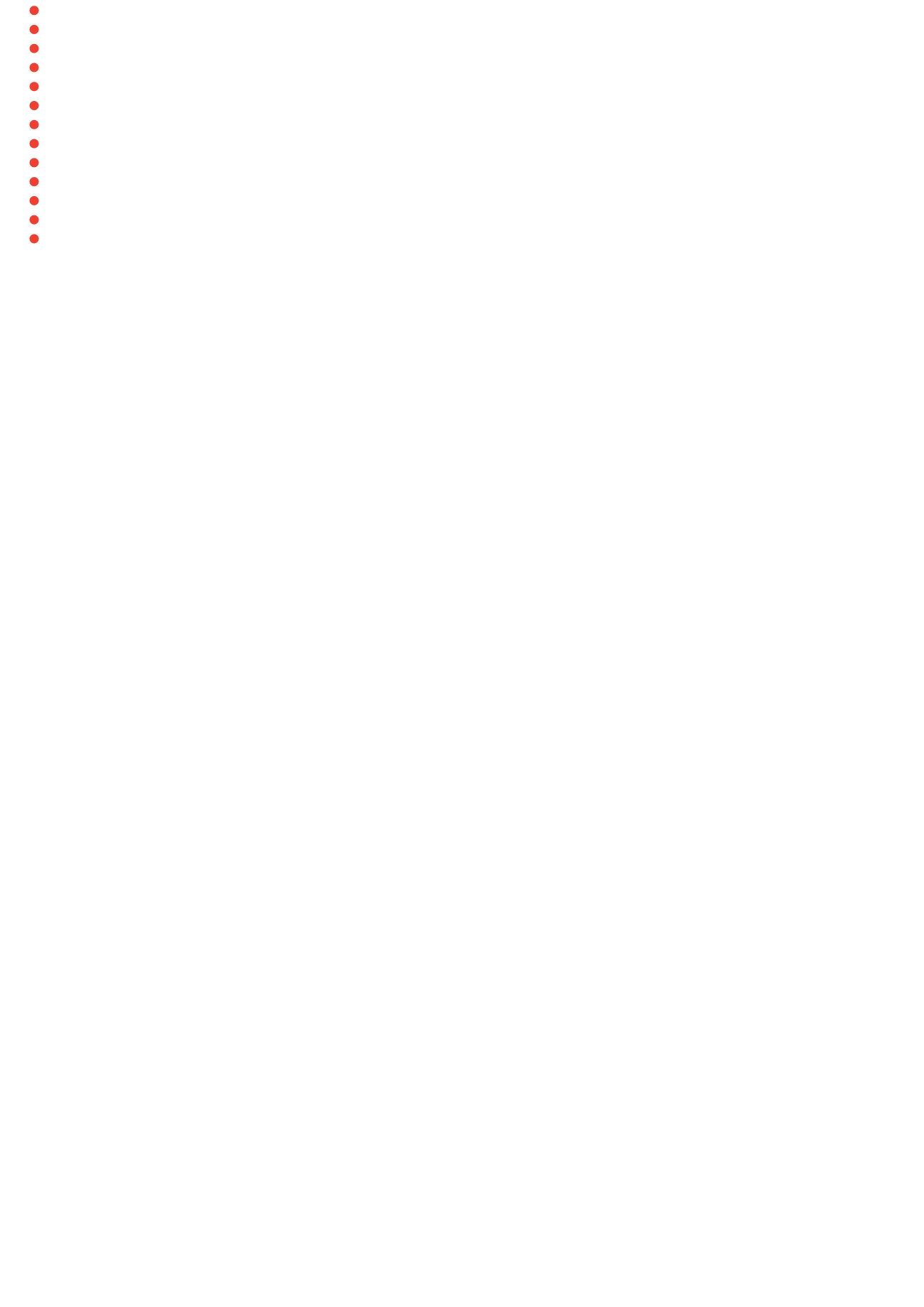
TANGRAM 34
|
12/2014
Aus der Kommission
|
Nouvelles de la commission
|
La commissione informa
Rechtsprechung
|
Jurisprudence
|
Giurisprudenza
18
LeugnungvonGenozid
Ein weiterer Tatbestand, der nach Artikel
261
bis
StGB unter Strafe gestellt wird, ist das
Rechtfertigen, Verharmlosen oder Leugnen
von Völkermord. Das Schweizerische Bundes-
gericht verurteilte 2007 einen türkischen Par-
teipräsidenten.
5
Dieser hatte anlässlich seines
Aufenthalts in der Schweiz öffentlich geäus-
sert, dass der Genozid an denArmeniernAn-
fangdes 20. Jahrhunderts eine«internationa-
leLüge» sei.DerVerurteiltezogdenEntscheid
des Bundesgerichts weiter an den Europäi-
schenGerichtshof fürMenschenrechte EGMR.
DerGerichtshof hiess dieBeschwerdegut und
stellte fest, dass die Schweiz, indem sie den
türkischen Parteipräsidenten verurteilt hatte,
dessenMeinungsäusserungsfreiheitnachArti-
kel 10 der EuropäischenMenschenrechtskon-
vention EMRK verletzt habe.
6
Die Mehrheit
der Strassburger Richter begründete den Ent-
scheid damit, dass international kein «gene-
reller Konsens» über die rechtliche Qualifika-
tionderEreignissevon1915vorherrsche. Zwei
Richter vertraten jedoch eine abweichende
Meinung und unterstrichen, dass der Völker-
mord an den Armeniern in denmeisten Län-
dern als Genozid qualifiziert werde und dass
zwischen verschiedenen Völkermorden nicht
unterschieden werden dürfe. Das Urteil wird
nun an die Grosse Kammer des Gerichtshofs
weitergezogen, welche voraussichtlich im Ja-
nuar endgültigentscheidenwird.
DasUrteilhat inderGesellschaftgemischte
Reaktionen ausgelöst. Es handelt sich um ein
für denEGMReher ungewöhnlichesUrteil, da
sich dieser in der Regel immer sehr stark ge-
gen Rassismus und Diskriminierung jeder Art
ausspricht. Es ist irritierend, dass der Gerichts-
hof die rechtliche Qualifikation des Massen-
mords andenArmeniern als Genozid anzwei-
felt. Der fehlende internationale politische
Konsens spielt gar keine Rolle, denn Richter
können die Rechtslage anhand der histori-
unterArt. 261
bis
StGB fallen,wenn sieals Sam-
melbegriffe oder Synonyme für verschiedene
Rassen oder Ethnien zu verstehen seien.
2
Dies
könne nicht schon bejaht werden, nur weil
der Betroffene offenbar aussereuropäischer
Herkunft sei. Das Bundesgericht argumen-
tiert weiter, dass Ausdrücke wie «Sau» oder
«Dreck» im deutschen Sprachraum gängige
Unmutsäusserungen und Missfallenskundge-
bungen seien. Derartige Äusserungen wür-
den als blosse Beschimpfungen und nicht als
AngriffeaufdieMenschenwürdeempfunden.
Nichts anderes gelte bei der Verwendung im
Zusammenhang mit bestimmten Nationalitä-
tenoder Ethnien.
Dieser Entscheid wurde in der Gesell-
schaft ebenfalls stark kritisiert. Vor allem
der Umstand, dass es sich beim Täter um ei-
nen Polizisten handelte, war stossend. Auch
in diesem Fall überzeugt die Argumentation
des Bundesgerichts nicht. Die Lehre vertritt
nämlich die Auffassung, dass es sich bei Be-
griffenwie «Ausländer» und «Asylant» sogar
«zweifelsfrei» um Sammelbezeichnungen für
bestimmte Ethnien handle, wenn die Gruppe
beschimpft werde («Huere X», «Scheiss-Y»,
«Sau-Z»).
3
In der kantonalen Rechtsprechung
wird teilweise unterschieden, ob das abwer-
tendeWort vor- oder nachgestellt ist. So ver-
letzt zum Beispiel der Ausdruck «X-Sau» die
Menschenwürde, da mit ihm der fraglichen
Gruppe die Qualität als menschliches Wesen
abgesprochen werde bzw. er «die Gleichstel-
lung [dieser Gruppe] mit Säuen vermuten
lässt».
4
Hingegen gelte «Sau-X» als blosse Be-
schimpfung, da in diesem Fall dieMenschen-
würdenicht tangiertwerde. Eswirdaberauch
nach der Intensität der Beschimpfung unter-
schieden. Diese Argumentationsansätze wä-
ren überzeugender gewesen als der des Bun-
desgerichts.